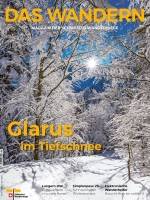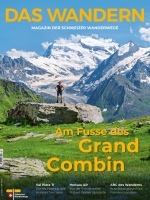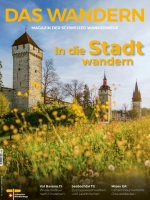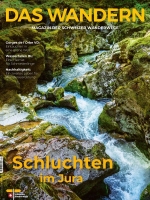Outdoorkleider erfüllen den Zweck, den menschlichen Körper bei sportlichen Aktivitäten und bei wechselnden Wetter- und Temperaturbedingungen möglichst lange in der persönlichen Komfortzone zu halten. Das heisst konkret: weder zu kalt noch zu warm und möglichst trocken.
In der Praxis hat sich beim Wandern das Zwiebelschalenprinzip am besten bewährt – also mehrere statt nur eine Bekleidungsschicht, um schnell und flexibel auf die wechselnden äusseren Bedingungen reagieren zu können.
Haut schwitzt weiter bei der Rast
Ein gutes Beispiel dafür ist die Phase der Rast nach einem anspruchsvollen Aufstieg. Beim Wechsel von intensiver Anstrengung zu Ruhe laufen im Körper verschiedene physiologische Prozesse ab, die teilweise verzögert auf die neue Situation reagieren. Diese Übergangsphase ist kritisch für das Wärmeempfinden, die Thermoregulation und das Wohlbefinden.
Die Körperkerntemperatur bleibt zunächst erhöht, auch nach dem Stopp, und die Schweissdrüsen arbeiten weiter, obwohl keine Wärmeproduktion mehr durch Muskelarbeit erfolgt. Dies führt dazu, dass man nachschwitzt und der nasse Körper bei Wind oder kühler Umgebung schnell auskühlt. Die Körperoberfläche bleibt warm und feucht, was bei plötzlicher Inaktivität zu übermässiger Wärmeabgabe führt. Die zuvor nützliche Verdunstungskälte wird nun zum Nachteil und erhöht das Risiko für Unterkühlung, besonders bei Wind, Schatten oder feuchter Kleidung. Zeit also, etwas Warmes anzuziehen.
Wind kühlt Körper schnell aus
Noch effektiver wäre es, darüber noch eine Wetterschutzjacke anzuziehen. Denn auf einem Gipfel ist man Wind und Wetter stark ausgesetzt. Die Gefahr, rasch auszukühlen, ist gross, denn die Kleider sind feucht und der Schweiss verdunstet schneller, als es gut wäre. Dazu kommt der Windchilleffekt. Er beschreibt das Phänomen, dass sich kalte Luft bei Wind deutlich kälter anfühlt, als sie tatsächlich ist. Der gefühlte Temperaturunterschied kann dabei enorm sein: Bei +5 °C Lufttemperatur und 40 km/h Wind fühlt es sich an wie –5 °C.
Die erste Schicht: Funktionsunterwäsche
Die direkt auf der Haut liegende Funktionsunterwäsche nimmt die Schwitzfeuchtigkeit auf und transportiert sie nach aussen. Bei Pausen sollte die Funktionsunterwäsche also möglichst schnell trocknen und so ein Auskühlen verhindern.
Wasserleitfähigkeit
Die erste Textilschicht soll den Schweiss aufnehmen, über eine grosse Fläche verteilen und an die äusseren Bekleidungsschichten weiterleiten. Idealerweise in einer Geschwindigkeit, welche die natürliche Kühlfunktion des Schweisses nicht komplett unterbindet.
Rücktrocknungszeit
Wasser leitet etwa 25-mal besser als Luft, deshalb entzieht eine nasse erste Schicht dem Körper förmlich die Wärme – unabhängig davon, ob die Kleider vom Regen oder vom Schweiss nass sind. Deshalb ist die Wahl des Materials entscheidend: Baumwolle trocknet extrem langsam – in über zwei Stunden – und ist deshalb für sportliche Aktivitäten nicht geeignet. Dagegen trocknet Merinowolle je nach Garnstärke in einer bis eineinhalb Stunden, Polyester-Mikrofasern brauchen nur 15 bis 30 Minuten.
Die zweite Schicht: Isolationsschicht
Die Isolationsschicht schliesst Luft ein. Diese verhindert, dass Körperwärme zu schnell an die Umgebung abgegeben wird oder dass Kälte von aussen zum Körper dringt. Die zweite Schicht wärmt folglich nicht, sie hält lediglich die Wärme des Körpers zurück und die kalte Umgebungsluft vom Körper fern.
Luft leitet Wärme sehr schlecht. Diese Eigenschaft nutzen Isolationsjacken, ihre Füllungen bilden dicke Luftpolster: Daunen enthalten 85 bis 90 Prozent eingeschlossene Luft, Kunstfasern 70 bis 85 Prozent und Wollwattierung etwa 60 bis 70 Prozent.
Vor- und Nachteile der Materialien
Daunen, Kunstfaser- sowie Wollwattierungen haben Vor- und Nachteile. Daune isoliert am besten, solange sie trocken ist – bei Feuchtigkeit nimmt ihre Leistung jedoch stark ab. Kunstfaserwattierung isoliert gut, auch wenn sie nass ist, und trocknet schnell. Wollwattierung hat eine mittlere Isolationsleistung und trocknet moderat schnell.
Daune hat das beste Verhältnis von Gewicht zu Wärmeleistung und das kleinste Packmass, ist aber teuer und pflegeintensiv. Kunstfaserwattierung ist pflegeleicht und kostengünstiger, hat aber ein grösseres Packmass. Wollwattierung ist ebenfalls pflegeleicht und kostengünstig, aber schwerer und weniger komprimierbar.
Wie Wärme verloren geht
Neben der Nässe kann die Isolationsleistung aber auch durch andere Dinge reduziert werden: Wo der Rucksack am Körper aufliegt, sind die Luftpolster zusammengedrückt. Sitzen Kleider nicht gut oder sind sie zu klein oder zu gross, geht ebenso Körperwärme verloren.
Schliesslich verliert der Körper Wärme über Kältebrücken – diese gilt es schon beim Kauf von Kleidern zu vermeiden. Zum Beispiel nicht mit Stoff hinterlegte Reissverschlüsse oder zu viele Nähte.
An den Beinen fehlt die Isolationsschicht meistens. Das rächt sich, wenn man sich bei der Rast zum Beispiel auf einen kalten Stein setzt: Die Körperwärme geht über diese Kältebrücke schnell verloren.
Die dritte Schicht: Wetterschutzschicht
Die Wetterschutzschicht hält Wind, Regen und Schnee vom Körper fern und lässt gleichzeitig die Schwitzfeuchtigkeit entweichen. Die Laminate haben zwei oder drei Lagen: Das Trägertextil und die Membran bilden die Grundlagen, ein Futterstoff oder eine Beschichtung bilden die dritte Lage.
Die Fähigkeit eines Laminats, Schweiss vom Körper weg nach aussen zu transportieren, wird in den Masseinheiten MVTR (moisture vapor transmission rate) oder RET (resistance to evaporating heat transfer) angegeben. Je höher der MVTR-Wert, desto besser. Je tiefer der RET-Wert, desto besser.
Wetterschutz und Schweissdurchlass der dritten Schicht werden eingeschränkt durch:
Leistungslimits der Membran
Nicht alle Membrane sind gleich leistungsfähig. Und selbst die besten Produkte lassen auch bei idealen Bedingungen – die es nur selten gibt – nur rund einen Liter Schwitzfeuchtigkeit pro Stunde entweichen. Bei hoher sportlicher Intensität kann der menschliche Körper jedoch zwischen einem und drei Litern Schweiss ausstossen und so jede noch so hochfunktionale Jacke an ihre Leistungsgrenze bringen.
Wenig Gefälle von Temperatur und Feuchtigkeit
Je grösser das Temperaturgefälle, desto besser funktionieren Wetterschutzjacken. Ideal sind 32 Grad an der Jackeninnenseite und 15 Grad Aussentemperatur.
Auch die Feuchtigkeit inner- und ausserhalb der Jacke spielt eine grosse Rolle: Je grösser das Gefälle, desto besser kann der Schweiss an die Umgebungsluft abgegeben werden. Ideal ist eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit an der Jackeninnenseite und sehr trockene Luft an der Aussenseite.
Bei tropischen Bedingungen mit hohen Temperaturen und beinahe 100 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit kommt der Schweisstransport zum Erliegen. Auch in unseren Breitengraden darf man sich nicht wundern, wenn bei einem Sommergewitter und hohen Temperaturen und entsprechend hoher Luftfeuchtigkeit die Jacke an ihre Leistungsgrenze kommt.
Tiefe Temperaturen
Warme Luft kann mehr Luftfeuchtigkeit aufnehmen als kalte. Je kälter also die Umgebungsluft, desto weniger Schwitzfeuchtigkeit kann das Laminat abgeben. Besonders bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt verlieren Wetterschutzjacken deshalb stark an Atmungsaktivität.
Schlechte Imprägnierung
Nicht alle Imprägnierungen sind gleich leistungsfähig. Sämtliche Imprägnierungen verlieren auf Dauer ihre ursprüngliche Leistungsfähigkeit. Saugt sich in der Folge der Oberstoff mit Wasser voll, kann durch die darunter liegende Membran nur noch wenig Schwitzfeuchtigkeit entweichen. Das nennt man Wet-out-Effekt.
Manchmal lässt sich die Imprägnierung mit Wärme (Glätteisen auf tiefer Stufe oder Wäschetrockner) wieder reaktivieren. Andernfalls ist die Wetterschutzjacke mit einem entsprechenden Spezialprodukt neu zu imprägnieren.
Seit Kurzem dürfen in der EU bei der Behandlung von Textilien keine per- und polyfluorierten Chemikalien (PFC/PFAS) verwendet werden. Diese Chemikalien wurden lange Zeit eingesetzt, um Materialien wasser-, schmutz- und ölabweisend zu machen. Sie sind aber umwelt- und gesundheitsschädlich und bauen sich in der Natur nicht ab. Dies hat ihre Kehrseite: Die alternativen Imprägnierungen sind leider bedeutend weniger leistungsfähig.